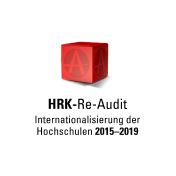Biomaterialien
Forschungsaktivitäten Kemkemer-Lab
Aktuelle Forschungsprojekte befassen sich mit den Themen
- Organ-on-Chip Modelle und Migration von Tumorzellen
- Zellfragmente - Motilitätsprinzipien und Anwendung als autonome Transporter
- Biokompatibilität - Entwicklung und Testung von Biomaterial-Grenzflächen
Die Arbeiten werden unterstützt durch das BMBF, das Land Baden-Württemberg, die Baden-Württemberg Stiftung, den DAAD, den Stifterverband der Deutschen Wirtschaft, die Vector Stiftung (Stuttgart), dem MWK Baden-Württemberg - "Programm zur Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Promotionsverfahren durch Förderung kooperativer (Einzel-) Promotionen – HAW-Prom“ und anderen.
Forschungsprojekte
Es werden verschiedene Technologien zur Strukturierung und chemischen Modifizierung von Materialoberflächen eingesetzt. Mit zellbiologischen Methoden wird das Verhalten verschiedener Zelltypen untersucht.
Insbesondere interessieren wir uns dafür, wie Zellen Oberflächentopographien wahrnehmen und wie spezifische Oberflächeneigenschaften genutzt werden können, um Zellen in vitro und in vivo zu kontrollieren oder zu manipulieren.
Verbundprojekt: Biomimetische Interpositionsimplantate zur Behandlung von Kniegelenksarthrose (TOKMIS) in Kooperation mit Prof. Dr. Günter Lorenz
Arthrose, ein degenerativer Prozess der Gelenke, ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung. Etwa ein Drittel aller Menschen über 70 Jahre leiden derzeit an Arthrose. Hierbei ist nicht selten das Kniegelenk betroffen. Man unterscheidet eine laterale und mediale Kniegelenksarthrose, wobei mit letzterer eine Manifestation der Arthrose im zur Körpermitte gerichtete Teil des Gelenks bezeichnet wird. Zur Behandlung der medialen Kniegelenksarthrose gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese weisen bisher jedoch geringe Erfolgsraten auf und sind mit aufwendigen Operationen und langen Rehabilitationszeiten verbunden. Hauptziel des Verbunds ist es daher eine neuartige, minimal-invasive Methode zur Behandlung der medialen Kniegelenksarthrose zu entwickeln. Dabei soll ein elastisches Knieimplantat (Kniespacer) mit optimierten Materialeigenschaften und einer patienten-spezifisch angepassten Form entwickelt werden. Zusätzlich soll eine Software zur präoperativen Planung des Eingriffes erstellt werden. Die entwickelten Kniespacer-Prototypen werden auf ihre biologische Verträglichkeit, biomechanische Funktion und Haltbarkeit unter Belastung getestet. Anschließend sollen die optimierten Kniespacer in einer klinischen Pilotstudie getestet werden. Im Verbund TOKMIS arbeiten sieben interdisziplinäre Arbeitsgruppen an der Entwicklung dieses neuen Behandlungskonzepts zur Kniegelenksarthrose.
Die Invasion von Zellen in umliegendes Gewebe, die Ausbreitung durch Blut- und Lymphsystem und die Bildung von Metastasen transformieren einen lokal wachsenden Tumor in eine systemische und lebensbedrohliche Krankheit mit schlechter Prognose. Dabei spielt die aktive Migration der Tumorzellen eine entscheidende Rolle, ein komplexer Vorgang, der sowohl von chemischen als auch von physikalischen Eigenschaften der extrazellulären Umgebung abhängt. Hierbei spielen auch endogene, also in vivo auftretende elektrische Felder eine Rolle, welche die aktive Migration und das Wachstum von Zellen beeinflussen.
Primäres Ziel ist die Entwicklung und Herstellung zweier neuartigen Mikrofluidik-Chips zur Anwendung der in vitro Untersuchung der Migration von Tumorzellen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
Die entwickelten Zellmigrations-Chips könnten ein wichtiges Werkzeug für zahlreiche Forschungslabore darstellen. Langfristig soll der Chip weiterentwickelt werden, um zum Beispiel auch aus Patientenblut isolierte, zirkulierende Tumorzellen, sogenannte CTS (Circulating Tumor Cells) zu untersuchen. Weiterhin könnten die 3D-Chips realistische in vitro Untersuchungen zum Metastasierungpotential von patientenspezifischen Zellen ermöglichen und eventuell als eine Plattform zur Entwicklung von therapeutischen Anwendungen von elektrischen Feldern dienen.
Gefördert durch das MWK Baden-Württemberg - "Programm zur Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Promotionsverfahren durch Förderung kooperativer (Einzel-) Promotionen – HAW-Prom.
Die Invasion von Zellen in umliegendes Gewebe und die Bildung von Metastasen transformieren einen lokal wachsenden Tumor in eine systemische und lebensbedrohliche Krankheit mit schlechter Prognose. Dabei spielt die aktive Migration der Tumorzellen eine entscheidende Rolle, ein komplexer Vorgang, der auch von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der extrazellulären Umgebung abhängt. Auf Grund der enormen medizinischen Relevanz der Tumorzellinvasion, gibt es mehrere experimentelle Untersuchungsmethoden, die teilweise auch kommerziell erhältlich sind. Allerdings bilden diese Methoden nur bedingt die Komplexität der in vivo Situation ab, bzw. sind limitiert in der definierten Variation von entscheidenden Parametern, wie beispielsweise der mechanischen Steifigkeit oder geometrischen Verengungen in der Umgebung.
Primäres Ziel dieses interdisziplinären Projektes ist die Entwicklung und Herstellung eines neuartigen Mikrofluidic-Chips zur Anwendung in der in vitro Untersuchung der Migration von Tumorzellen.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines biologisierten Lunge-auf-Chip-Systems als Modell für die Atemanalyse und weiterer Anwendungen (Kooperation mit AG Kluger)
Das Projekt wird von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert.
Motilitätsprinzipien und Anwendung von Zellfragmenten aus humanen Blutzellen als autonome Transporter
Gefördert durch die Vector Stiftung.
Kooperation mit Dr. Tim Eiseler Universitätsklinikum Ulm.
Ansprechpersonen

Studiendekan Bachelor-Studiengang Biomedizinische Wissenschaften

Biomaterialien, Mikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie